Laufende Projekte
ICARET - Concepts of Interculturality and Alterity: Renewing Elements for Training – Internationales und interdisziplinäres Erasmus+ Projekt zur Theorie und Praxis des Interkulturellen, kofinanziert durch die Europäische Union
Unter der Leitung von Klaus Feldmann und der Mitarbeit von Gerald Hartung sowie Silvana Alberti beteiligt sich der Arbeitsbereich Didaktik der Philosophie an dem Erasmus+ Projekt zur Erforschung aktueller Konzepte und der Entwicklung von Trainings zur Interkulturalität. Das Gesamtprojekt wird von Cathy Sablé von der Hochschule IMT Atlantique in Brest/Frankreich geleitet, Vertreter/-innen von Universitäten in Italien, Kroatien, Marokko und Spanien sind ebenfalls beteiligt, weitere Informationen sind auf der Internetseite des Projekts zu finden.
Zwar gibt es viele Überlegungen und Handreichungen zur interkulturellen Theorie und Praxis, jedoch lässt sich trotz steigender gesellschaftlicher Mobilität einen Trend, häufig im Gestus populistischer Narrative zu Separatismus und Abgrenzung bis hin zu Nationalismus feststellen. Interkulturalität verstanden als ein Vergleich von Unterschieden und entsprechenden Handlungsempfehlungen ist konzeptionell nicht in der Lage, diesen Herausforderungen gerecht zu werden, leistet in dieser Form durch ihre Betonung von Unterschieden oft Vorschub für Ausgrenzung.
In dem Projekt werden daher Ansätze von Interkulturalität sprachwissenschaftlich, philosophisch sowie diskusanalytisch erneut kritisch erforscht, konzeptionell weiterentwickelt und entsprechende Praktiken für den aktuellen Bedarf konkret entworfen.
Im Rahmen des Projektes findet eine internationale Konferenz vom 15.-17. April 2026 an der Bergischen Universität Wuppertal statt, einen Aufruf für Vorschläge (Call for abstracts) für einen Vortag findet sich hier.
Abgeschlossene Projekte
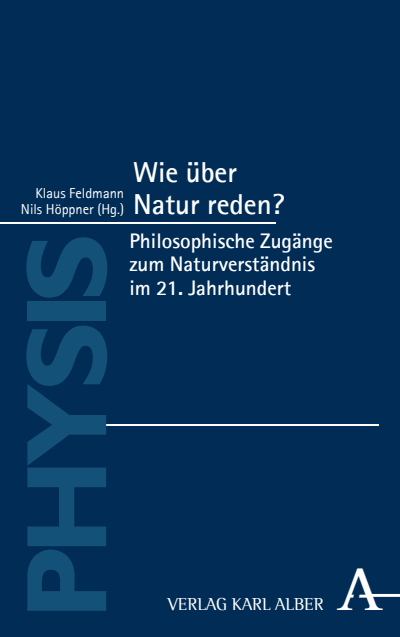
1. Welche Natur brauchen wir für ein gutes Leben?
Zur Bedeutung von Natur im 21. Jahrhundert
Die modernen westlichen Gesellschaften finden sich in einer ökologischen Krise en permanence. Dabei ist in Wissenschaft und Öffentlichkeit eine zunehmende Spannung zwischen Deutungsmustern zu erkennen. Einerseits wird die Naturalisierung von Kultur, andererseits die Kulturalisierung von Natur propagiert. Unter dem Druck der Spannung zwischen diesen beiden gleichsam hegemonialen Tendenzen der Selbstverständigung des Menschen über die Wechselbeziehungen zwischen Natur und Kultur wird zunehmend fraglich, was Natur ist und welche Bedeutungen sie für uns hat. Unter den Stichworten "Natur und Kultur", "Natur und Mensch in ökologischer Perspektive" und "Natur und ein gutes Leben" werden wir gemeinsam mit Schülerinnen und Schüler als auch Studierenden Orientierungskurse erarbeiten, die Grundlage eines bewussten und nachhaltigen Umgangs mit Natur als Umwelt des Menschen sind. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende werden als künftige Generation von Entscheidern in Politik, Wissenschaft und Lebenswelt darauf vorbereitet, dass ethische Reflexionen und politisches Handeln in Bezug auf "Natur" vor der Herausforderung stehen, die Kluft zwischen Verfügungs- und Orientierungswissen zu erkennen.
Das Projekt soll vor diesem Hintergrund eine fortlaufende und nachhaltige Netzwerkstruktur zwischen der Fachgruppe Philosophie der Universität und verschiedenen Schulen im Fach Philosophie schaffen. Es hat zum einen zum Ziel, SuS zu Arbeitsprozessen und Forschungsprojekten im Gebiet der (Natur-)Philosophie zu aktivieren. Zum anderen sollen die Lehramtsstudierenden die Gelegenheit erhalten, ihr didaktisches Verständnis im Umgang mit den SuS jenseits von institutionellen Zwängen zu erproben und reflektieren. Unter Rückgriff auf die Verfahren der qualitativen Sozialforschung sollen hieraus meta-didaktisch Rückschlüsse für ein differenziertes Verständnis der philosophiedidaktischen Handlungskompetenz gezogen werden – um zur Professionalisierung und Bildung von (zukünftigen) LehrerInnen nachhaltig beizutragen.
Das Projekt wurde von Prof. Dr. Hartung und Dr. Klaus Feldmann geleitet und fand von 2015 – 2018 in Kooperation mit Projektkursen des Gymnasiums am Kothen und des Carl-Fuhlrott-Gymnasiums in Wuppertal statt. Es wurde im Rahmen der Reihe Denkwerk von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert und aus ihm erwuchs die Veröffentlichung Wie über Natur reden. Philosophische Zugänge zum Naturverständnis im 21. Jahrhundert, herausgegeben von Klaus Feldmann und Nils Höppner.
